Die Europäische Zentralbank hat angekündigt, eine eigene App für den digitalen Euro zu entwickeln. Sofort stellt sich die Frage: Warum eigentlich?
Bisher hieß es, die Banken sollten den digitalen Euro über ihre eigenen Apps an die Bürger ausgeben. Warum geht die EZB also jetzt selbst diesen Schritt und verlässt sich nicht mehr allein auf die Institute? Steckt mehr als nur eine technische Spielerei dahinter?
Kurz erklärt: Der digitale Euro wäre eine neue Form von Zentralbankgeld, also das gleiche wie Bargeld, nur eben in elektronischer Form. Mehr Grundlagen dazu habe ich in einem eigenen Artikel behandelt.
Die offizielle Aussage der EZB zur eigenen App
In einer Rede Anfang September 2025 hat die EZB selbst erklärt, warum sie eine eigene App plant. Sie soll als Basislösung dienen – gewissermaßen als Fallback, falls Banken oder Zahlungsdienstleister ausfallen. Die Argumente lauten: mehr Resilienz (= Widerstandsfähigkeit) im Zahlungsverkehr, mehr Inklusion (=Miteinbeziehung) für Menschen ohne Bankkonto, eine barrierefreie Gestaltung für Bürger, die mit der Digitalisierung bisher überfordert sind.
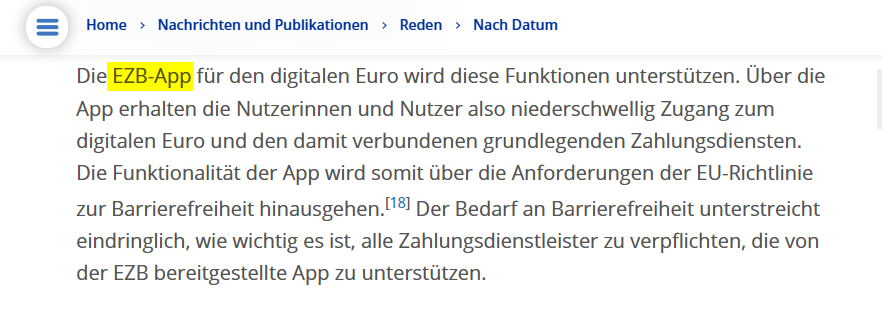
Die Botschaft ist klar: Die EZB will niemanden ausschließen. Gleichzeitig betont sie, dass die Banken die Hauptrolle behalten sollen. Sie sollen auch weiterhin die zentralen Anbieter bleiben, während die EZB-App nur eine Ergänzung ist.
Das klingt beruhigend, oder? Aber so einfach ist es leider nicht.
Was bedeutet die EZB-App für die Banken?
Kritisch betrachtet: Wenn es einen digitalen Euro geben soll, wäre es nicht völlig ausreichend, wenn Banken die Wallets einfach in ihre Apps integrieren? Schließlich sind sie seit Jahrzehnten die Schnittstelle zu den Konten. Eine eigene App würde jedoch bedeuten, dass die EZB direkten Zugang zu den Bürgern hätte – ohne Umwege über die Banken.
Vielleicht geht es aber auch um Kontrolle. Heute dominieren PayPal, Apple Pay und Google Pay den digitalen Zahlungsverkehr. Mit dem digitalen Euro will die EZB einen Gegenpol schaffen: eine europäische, nicht profitorientierte Alternative, die nicht von US-Konzernen kontrolliert wird. Doch dieser Schritt schwächt unweigerlich die Rolle der Banken, auch wenn die EZB das Gegenteil betont.
Darüber hinaus könnte das Ganze auch ein gewisses Druckmittel gegen die Banken sein. Wenn Banken Services rund um den digitalen Euro nur widerwillig oder zu teuer anbieten, kann die EZB jederzeit einspringen und die Institute somit indirekt unter Druck setzen.
Die Krisen-Logik der EZB
Ein zentrales Argument lautet: Sicherheit in der Krise. Die App soll als Notfalllösung dienen, selbst wenn einzelne Banken oder Fintechs ausfallen. Man soll damit einfach auf andere Infrastrukturen wechseln können. Dazu gehört auch eine geplante Offline-Funktion, die Zahlungen ohne Internetverbindung ermöglichen soll.
Doch wie realistisch ist das? Wenn der Strom länger ausfällt, hilft keine App der Welt. Wer kein Bargeld zu Hause hat, kann heute genauso wenig zahlen wie morgen. Das Sicherheitsversprechen wirkt also wenig überzeugend.
Die Frage bleibt: Braucht es wirklich eine EZB-App oder könnte man die Bürger nicht einfach dazu anhalten, Bargeld als Krisenvorsorge zu behalten? Denn Bargeld ist unkompliziert und erprobt – dafür muss man nichts Neues erfinden.
Wie geht es weiter mit dem digitalen Euro?
Eines ist klar: Der digitale Euro ist noch nicht beschlossen. Doch die Weichen dafür werden jetzt gestellt – und die Richtung ist eindeutig: Die EZB will die Währung nicht nur im Hintergrund verwalten, sondern auch im Alltag der Bürger sichtbar werden.
Bisher wurde nur am Rande erwähnt, dass es eine Art Basis-App geben könnte. Nun ist klar, dass die EZB diese selbst entwickeln will. Mit der App hätte die EZB erstmals unmittelbaren Kontakt zu den Menschen. Zunächst nur für Basisfunktionen, doch morgen vielleicht für mehr. Banken würden so langfristig teilweise überflüssig.
Hier stellen sich einige Fragen:
- Wem vertraust du mehr? Den Banken oder der EZB?
- Besteht die Gefahr, dass viele Bürger ihre Guthaben von Banken abziehen, weil es bei der EZB „sicherer” erscheint? Das könnte Bank-Runs auslösen.
- Wie abhängig macht uns eine zentrale App von der Technik? Was passiert bei Softwarefehlern, Systemausfällen oder ganz einfach, wenn der Akku leer ist?
- Und welche Limits wird es geben? Schon jetzt steht fest, dass das Guthaben im digitalen Euro beschränkt wird. Wie streng diese Grenzen jedoch ausfallen werden, ist noch unklar.
- Was bedeutet die Zentralisierung für die Zukunft?
Alles, was derzeit für den digitalen Euro „auf dem Papier steht”, hört sich ja gut an und hätte theoretisch auch Vorteile. Es gäbe mehr Wettbewerb unter den Banken, die dann eventuell attraktivere Angebote machen müssten. Vielleicht auch „mehr Sicherheit” für das Geld, weil das Thema Einlagensicherung für die EZB-Guthaben wegfällt? Die EZB kann schließlich nicht „pleitegehen”.
Für mich sind die neuen Aussagen aus der Rede bezüglich der EZB-App aber vor allem eines: ein Signal, dass die Zentralbank ihre Rolle im Zahlungsverkehr neu definiert. Die EZB hat deutlich gemacht, dass sie sich nicht mehr allein auf Banken verlassen will. Sie will selbst eine Rolle spielen – direkt auf deinem Smartphone.
